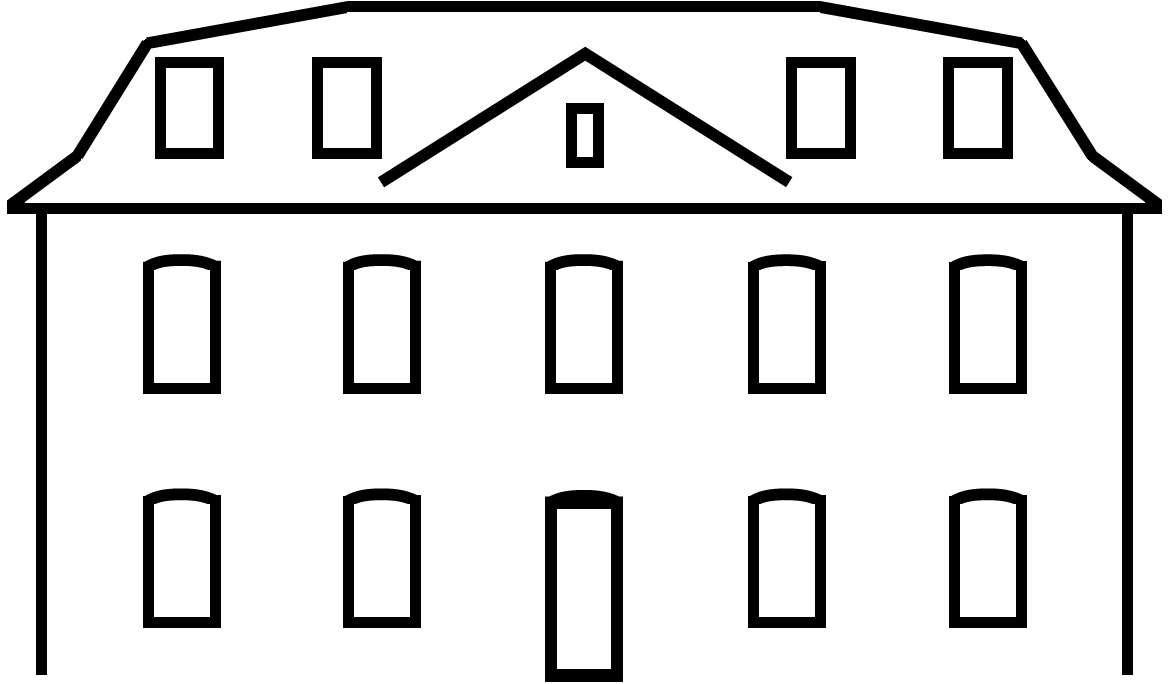VideoKunstNächte 2025/26


Der Film 100 Jahre von Surya Suran Gied und Angelo Angelino Wemmje erzählt von der letzten Begegnung Gieds koreanischen Mutter und ihrer 100-jährigen Großmutter. Er spielt sich im und um das Hauses ab, das in den 1970er Jahre mit dem Lohn von Gieds Mutter erbaut wurde, die durch das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Südkorea als Krankenpflegerin in Köln tätig war. Das filmische Porträt verbindet häusliche Szenen, Gespräche, Interview-Elemente und wiederkehrende Auftritte einer maskierten Figur zu einer alternierenden Struktur. Die maskierte Figur erscheint dabei wie ein Kommentar oder Begleiterin, vom Theater her gedacht könnten wir sie als stummer Chor lesen, der sich zwischen die einzelnen Teile einer Geschichte fügt. In diesem kinematografischen Gefüge entsteht Distanz und zugleich eine Form von Nähe, in der Sprachlosigkeit, Übersetzung und das Ringen um Worte zentrale Themen bilden. Die Frage in welchen Momenten weibliche Stimmen dabei Gehört fanden, innerhalb der familiären Struktur Gieds und im sozialen Gefüge von drei Generationen zwischen Südkorea und Deutschland ist dabei zentral.
Gieds Mutter fungiert hier als Mittlerin zwischen den Sprachwelten. Zwischen Enkelin und Großmutter besteht keine gemeinsame Sprache: Gied spricht kein Koreanisch, die Großmutter kein Deutsch und hat sich erst spät selbst ein wenig lesen beigebracht. Das daraus resultierende Nicht-Verstehen wird im Film selbst zu einer Form der Kommunikation. Es entsteht eine alternative Form von Literalität, die sich über Gesten, Blicke und alltägliche Handlungen vermittelt. Der Film kann so als eine Untersuchung von Erinnerung, Migration und den Grenzen sprachlicher Verständigung gelesen werden.
Einen anderen, aber strukturell vergleichbaren Ansatz zur visuellen Kommunikation entwickelte Paul Sharits 1965 in Sears Catalogue 1–3. In dieser Arbeit verdichtet Sharits die Bilderfülle amerikanischer Versandkataloge – insbesondere jener, die sich an ein weibliches Publikum der Nachkriegszeit richten – zu einem schnellen, repetitiven Filmstrom. Mit 24 Bildern pro Sekunde erscheinen die Katalogseiten als einzelne Frames, als Fragmente von Konsum und Begehren. Diese visuelle Überlagerung verweist zugleich auf die Repräsentation von Frauen im Film und in der Konsumkultur der 1960er Jahre. Hier erscheinen zwischen den einzelnen Konsumbildern, Darstellugnen von Frauen aus eben jenen Magazinen der 1960er Jahre. Durch die Schnelligkeit der Bildfolge bleiben den Betrahcter*innen nur wenige Sekunden um alles zu sehen – und bleiben mit nichts außer einer nicht zu verabreitendne Bilderflut.
Während Gied und Wemmje Beziehungen zwischen Generationen, Kulturen und Medien in einem langsamen Rhythmus erkunden, übersetzt Sharits das Blättern durch Bilder in ein technisches Rauschen. Beide Arbeiten untersuchen die Bedingungen, unter denen Bilder, Texte, Gesten und Gefühle gelesen, erfahren und erinnert werden, und wie daraus Narrative über Sichtbarkeit, Körper und Geschichte entstehen.
In diesen unterschiedlichen filmischen Ansätzen treffen private und globale Perspektiven des 20. Jahrhunderts aufeinander: bei Gied und Wemmje das intergenerationale Erbe zwischen Südkorea und Deutschland, bei Sharits die amerikanische Popkultur zwischen Werbung, Kunst und Kaltem Krieg. Beide Werke stellen die Frage, wie Geschichte in Bildern erzählt wird – und wer darin sichtbar wird.
Surya Suran Gied arbeitet an der Schnittstelle von Erinnerung, Migration und visueller Kultur. Ausgangspunkt ihrer Praxis ist ihre deutsch-koreanische Familiengeschichte, die Fragen nach Identität und Übersetzung prägt. In ihren multimedialen Arbeiten verbindet sie autobiografische Materialien – Fotografien, Erzählungen, Audio- und Filmaufnahmen – mit Archiven massenmedialer Bilder. Malerei dient ihr dabei als Mittel, das Unsichtbare und Ungesagte sichtbar zu machen. Gied studierte Freie Kunst an der Universität der Künste Berlin bei Valérie Favre (MfA 2008). Arbeitsaufenthalte und Stipendien, u. a. an der Deutschen Akademie Rom Casa Baldi (2023), im Seoul Art Space Geumcheon (2013) und bei der Pollock-Krasner Foundation in New York (2022), prägen ihr Werk. Für ihre Arbeit erhielt sie den Dieter-Ruckhaberle-Preis (2021).
Angelo Angelino Wemmje ist Autor und Filmemacher. Er studierte zunächst an der Universität der Künste Berlin und anschließend Mediale Künste mit dem Schwerpunkt Literarisches Schreiben und Drehbuch an der Kunsthochschule für Medien Köln, wo er 2018 mit dem Diplom abschloss. Bereits während des Studiums arbeitete er als Videokünstler und Filmeditor an mehreren Kinoproduktionen. Seither realisiert er eigene Kurzfilme, schreibt Drehbücher, Prosa und Lyrik. Sein Debütroman VENUS CHICAGO erschien 2023 bei Bartels & Bleil – Verlag für ästhetischen Widerstand. 2024 erhielt er das Jahresstipendium Literatur vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft & Kultur und wurde zuletzt mit dem Günter Rohrbach Drehbuchpreis ausgezeichnet. Seine Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Literatur und Film.
Seit jeher sind die Fenster der Kunsthalle ein weithin sichtbarer Teil des Gebäudes, der auch immer wieder in einzelne Ausstellungsprojekte integriert wurden. Mit der Übernahme der Museumsdirektion durch Nico Anklam im Sommer 2021 bekam dieser Teil des Gebäudes nicht nur sein altes Gesicht zurück mit der Öffnung der Fenster sondern wurde auch für die Wintermonate neu gedacht: nächtlich ab 18 Uhr abends ist Videokunst im südlichsten Fenster als Rückprojektion zu sehen. Umsonst und für jede*n zugänglich die ganze Nacht.
Informationen
| Dienstag - Sonntag und an Feiertagen | 11 bis 18 Uhr |
| Heiligabend und Silvester | 11 bis 14 Uhr |
| Montag | Geschlossen |
| Normal | 5 € |
| Ermäßigt* | 2,50 € |
| Kinder unter 14 Jahren | frei |
| Samstags | Pay-what-you-want |
| Öffentliche Führung jeden Sonntag 12:00 Uhr |
Die Kosten für eine gebuchte Führung betragen 55,- Euro pro Gruppe (max. 20 Personen). Anmeldung unter Telefon (02361) 50 19 35.
| Kunsthalle Recklinghausen |
| Große-Perdekamp-Straße 25–27 |
| 45657 Recklinghausen |
| Telefon: +49(0)2361-50-1935 |
| Telefax: +49(0)2361-50-1932 |
| E-Mail: info@kunst-re.de |